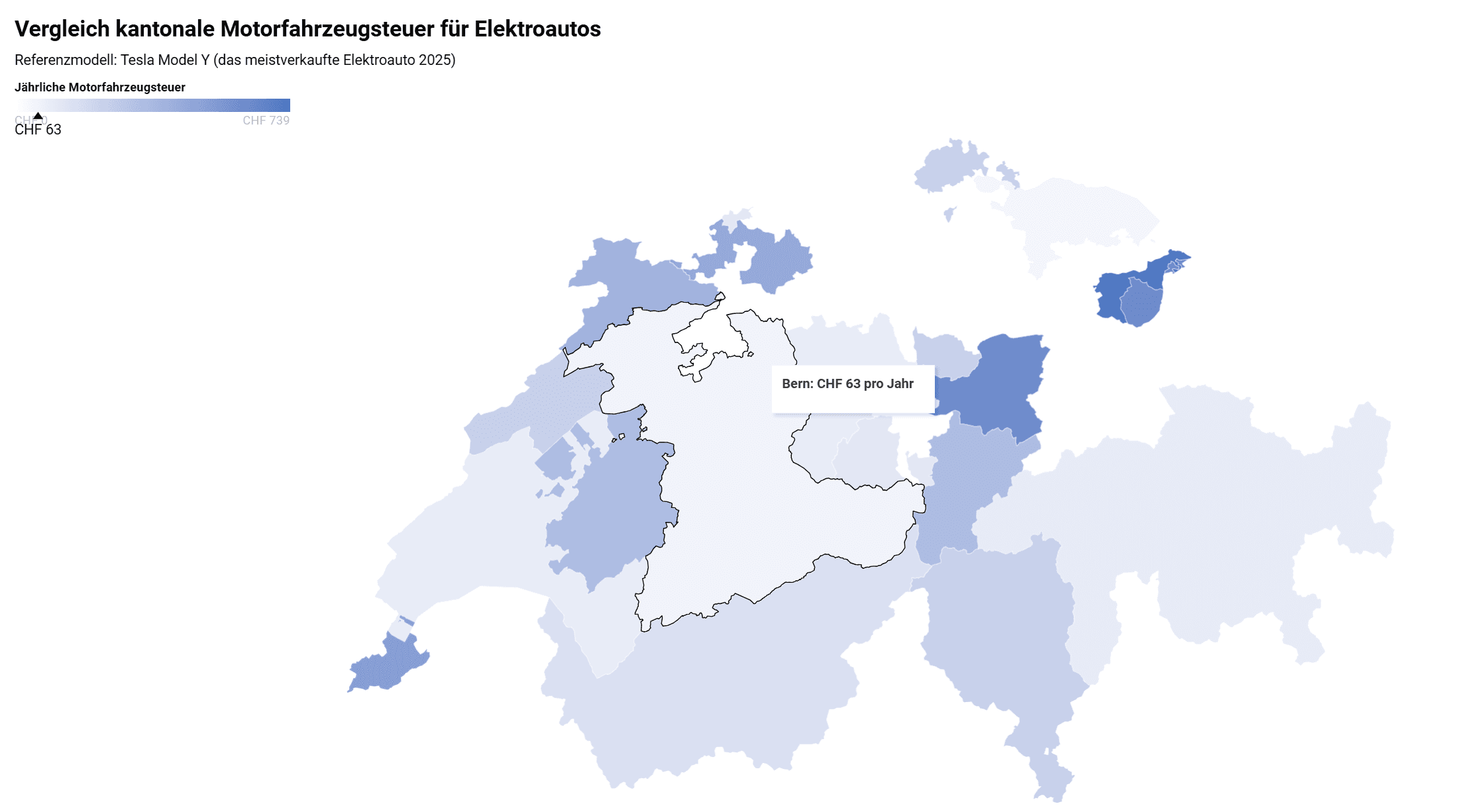Nein zur Ersatzabgabe: Swiss eMobility spricht sich klar gegen neue Steuern auf die Elektromobilität aus
Der Bundesrat hat zwei Varianten zur Besteuerung der Elektromobilität zur Vernehmlassung vorgelegt. Eine solche Abgabe bremst die Transformation zur fossilfreien Mobilität weiter aus. Wir lehnen eine weitere Abgabe auf Elektrofahrzeuge entschieden ab.
Kommentar Krispin Romang, Direktor Swiss eMobility
Mit der sogenannten «eAbgabe» will der Bundesrat künftig Einnahmen für die Strasseninfrastruktur generieren. Begründet wird dies mit erwarteten Ausfällen bei der Mineralölsteuer und dem Zuschlag zur Mineralölsteuer. Die eAbgabe soll spätestens 2030 eingeführt werden, entweder als Roadpricing pro gefahrenen Kilometer oder als Aufschlag pro Kilowattstunde an der Ladestation. Der Vernehmlassungsbericht stützt sich auf ein realitätsfremdes Szenario eines stark steigenden Elektromobilitätsmarktes. Ein Wachstum, dass in der Realität derzeit nicht stattfindet und aufgrund der aktiven Verhinderungspolitik auch kaum erreicht werden kann. So wird eine erhebliche Finanzierungslücke suggeriert. Während Europa derzeit massiv vorwärtsmacht, stagniert die Elektromobilität in der Schweiz seit 2023. Die Ziele der Roadmap werden deutlich verfehlt, Korrekturmassnahmen bleiben aus. Stattdessen wurden bei drohendem Strommangel über ein Elektroautoverbot diskutiert, die Autoimportsteuer auf Elektrofahrzeuge eingeführt und nun soll eine eAbgabe folgen. Und dies genau zu jenem Zeitpunkt, an dem die Emissionsziele von heute 93.6g CO₂/km auf 50g CO₂/km praktisch halbiert werden müssen. Dafür wäre eine Verdreifachung des Anteils batterieelektrischer Neuwagen nötig. Mit aktuell 105g CO₂/km wird die Schweiz übrigens erneut ein Jahresziel klar verfehlen. Die geplante eAbgabe stellt sich diametral gegen die vom Volk beschlossenen Klimaziele.
Die geplante Steuer soll analog zur Mineralölsteuer verschiedene Finanzierungstöpfe speisen: neben dem Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF) und der Spezialfinanzierung Strassenverkehr (SFSV) auch den allgemeinen Bundeshaushalt. «Während in den Nachbarländern aus der Staatskasse die Entwicklung der Elektromobilität beschleunigt, soll bei uns der Geldfluss in die umgekehrte Richtung gehen», stellt Swiss eMobility Direktor Krispin Romang fest. Bei fossilen Fahrzeugen wird die Mitfinanzierung des Bundeshaushalts durch hohe externe Kosten wie Lärmemissionen begründet. Dieses Argument gilt jedoch bei der Elektromobilität nicht. Zudem ist der Kostendeckungsgrad aller Fahrzeuge, unabhängig vom Antrieb, bereits heute sehr hoch. Sie finanzieren nicht nur den Bundeshaushalt sowie die Strassen-, sondern auch die Bahninfrastruktur mit.
Der NAF wird zudem durch Sanktionen bei Emissionsüberschreitungen gespiesen. In der Vergangenheit hat der Bundesrat diese Sanktionen jedoch mithilfe erleichternder Übergangsmechanismen reduziert und damit auf rund 1.6 Milliarden Franken für den NAF verzichtet. Die gewährten Rabatte gingen sogar weiter als in der EU und stellten ein «Swiss Finish» dar. Weitere Abstriche sind absehbar. «Es ist völlig widersprüchlich, dass der Bundesrat bei Emissionsüberschreitungen auf viel Geld verzichtet, gleichzeitig aber emissionsarme Mobilität zur Kasse bitten will», kritisiert Romang.
Besonders gravierend wären die Auswirkungen auf den Nutz- und Schwerverkehr. Die eAbgabe soll gleichzeitig mit der LSVA für elektrische Lastwagen eingeführt werden. Die zusätzlichen 21.5 Rappen pro Kilometer würden die Transformation im kostenkritischen Schwertransport schon vor dem Start vollständig zum Erliegen bringen. Bereits heute verläuft die Marktentwicklung bei elektrischen Nutzfahrzeugen deutlich unter den Erwartungen und dem eigentlichen Potenzial, nicht zuletzt wegen regulatorischer Erschwernisse. So wurden bei der sogenannten Auflastung von 3.5 auf 4.25 Tonnen Benachteiligungen geschaffen, die bis heute nicht behoben sind.
Hinzu kommen erhebliche Unsicherheiten bei den vorgeschlagenen Umsetzungsvarianten. «Die Schweiz ist Pionier bei der Einführung neuer Steuern, aber Schlusslicht beim Schaffen marktfreundlicher Rahmenbedingungen», so Romang. Entsprechend fehlen Erfahrungswerte. Ein Roadpricing nur für Elektromobilität wäre eine klare Diskriminierung. Für eine Abgabe auf den Ladestrom wären zudem Investitionen von 3.2 bis 3.7 Milliarden Franken nötig. Zudem liesse sich die Steuer mühelos über die Haushaltssteckdose umgehen.
Gleichzeitig tut der Bund nichts, um den geschwächten Markt zu stärken. Die Rahmenbedingungen für die Elektromobilität sind nirgendwo in Europa so schlecht wie in der Schweiz. Bevor zusätzliche finanzielle Belastungen eingeführt werden, braucht es dringend strukturelle Korrekturen: die rasche Einführung des Rechts auf Laden, die Beseitigung steuerlicher Nachteile für Dienstwagen, die konsequente Umsetzung der CO₂-Vorgaben sowie Unterstützung beim Aufbau eines netzdienlichen, intelligenten Ladenetzes – um nur die wichtigsten Punkte zu nennen. Solange diese Voraussetzungen fehlen, der Anteil der Elektrofahrzeuge am Gesamtmarkt einen signifikanten Anteil erreichen und sich die Schweiz auf CO₂-Zielerreichungskurs ist, lehnt Swiss eMobility weitere Steuern auf die Elektromobilität entschieden ab.